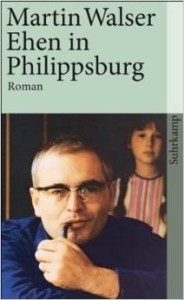 So einen Freund wenn er hätte
So einen Freund wenn er hätte
Seinen Ruf als «Chronist des Mittelstandes» hat Martin Walser gleich mit seinem ersten Roman begründet, 1957 erschienen unter dem deskriptiven Titel «Ehen in Philippsburg», womit das literarische Terrain bereits deutlich abgesteckt ist. Mag die Ehe als Institution in unserer Zeit ihren Alleinvertretungsanspruch auch eingebüßt haben, wie Soziologen versichern und Statistiken belegen, so war sie in der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders noch weitgehend «alternativlos», um ein Schlagwort von heute zu benutzen. In seinem Entwicklungsroman schildert der Autor in vier Kapiteln einen umgekehrt zum wirtschaftlichen Aufschwung verlaufenden Niedergang der Moral, das Zerbrechen von festgefügt scheinenden Bindungen.
Der aus der Provinz stammende Journalist Hans Beumann kommt in die Großstadt, um dort seine erste Anstellung zu finden. Dank seiner Studienkollegin Anne erhält er bei deren Vater, einem Fabrikanten von Rundfunk- und Fernsehgeräten, einen Job und findet dadurch schnell Aufnahme in die höheren Kreise der Stadt. Als Anne von ihm schwanger wird und abtreiben soll, wendet sie sich an den Gynäkologen Dr. Benrath, dem in diesem wie ein Reigen aufgebauten Plot das zweite Kapitel gewidmet ist, an dessen Ende der Selbstmord seiner Frau steht, die sein Verhältnis zur schönen Cecile nicht länger ertragen kann. Als der treulose Arzt seine Frau tot auffindet, schaltet er den Rechtsanwalt Dr. Alwin ein, ein Karrierist mit politischen Ambitionen und notorischer Schürzenjäger, der dann beim Flirten einen Autounfall verursacht, bei dem ein Motorradfahrer zu Tode kommt. Der Nachbar von Hans schließlich, der erfolglose Schriftsteller Klaff, von seiner Frau verlassen, begeht Selbstmord, als er auch noch seinen Job als Pförtner verliert, und hinterlässt Hans seine Manuskripte. Nach der Verlobung mit Anne wird Hans in einer grotesken Zeremonie zum «Ritter des Nachtclubs Sebastian» geschlagen, dem Treffpunkt der Prominenz, und landet später mit einer der Animierdamen im Bett, ein Fremdgänger schon vor der Ehe.
Alle diese lose miteinander verbundenen Figuren wirken irgendwie unsympathisch, besonders die Männer erscheinen in keinem guten Licht. Sie werden als rücksichtslose Erfolgsmenschen beschrieben, denen Emotionen weitgehend fehlen, die nur hinderlich scheinen auf ihrem Weg nach oben, zu Ruhm und Macht, zu Geld und Genuss. Walser stellt die Frauen als Accessoire dieser Mannsbilder dar, allenfalls schmückendes Beiwerk, ob als Ehefrau oder als Geliebte. Er beschreibt all dies aus typisch männlicher Sicht und benutzt über lange Passagen hinweg durchaus gekonnt den Bewusstseinsstrom als Stilmittel, – und überrascht dabei mit kuriosen Reflexionen. «Er war ein Ein-Mann-Theater», schreibt er zum Beispiel über die Gedankenwelt des selbstgefälligen Gynäkologen. Und über die Befindlichkeiten des Rechtsanwalts heißt es: «Bei jeder Frau, die er für sich gewann, fragte er nach seinen Vorgängern und ließ sich bestätigen, dass er sie alle bei weitem übertreffe». Hand aufs Herz, wem kommt das nicht bekannt vor?
Leider fällt der erzählerische Schwung nach den ersten beiden Kapiteln spürbar ab, die heraufbeschworenen Bilder erscheinen allmählich klischeehaft, und manche Formulierung fällt denn doch merkwürdig schwäbisch aus: «So einen Freund wenn er hätte!» Man zuckt auch zusammen, wenn man diesen Satz liest: «Alle gegen alle, sagte er, das ist Freiheit». Satirisch überzeichnet hat Martin Walser hier den Ehebruch als fast zwangsläufig und naturgegeben dargestellt, allerdings nur als männliches Fehlverhalten, die Ehefrauen des Romans scheinen allesamt dagegen gefeit zu sein, sie gehen ganz einfach nicht fremd. Wunschdenken eines machohaften Autors? Auch wenn sich in der Sache noch manches andere einwenden ließe, eine vergnügliche Lektüre ist der ironisch erzählte Roman allemal, den drei Todesfällen als überstrapaziertes dramaturgisches Mittel zum Trotz, vielleicht aber auch gerade durch solcherart Übertreibungen.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
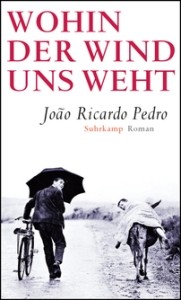 ker in spe
ker in spe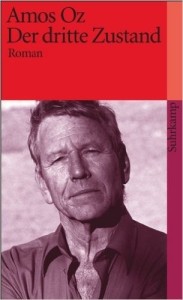 Licht von droben
Licht von droben Tonnerwetter
Tonnerwetter Es darf gedeutet werden
Es darf gedeutet werden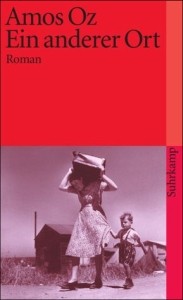 Im Mikrokosmos des Kibbuz
Im Mikrokosmos des Kibbuz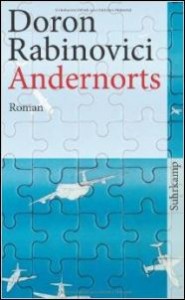 Auschwitz als Gottesbeweis
Auschwitz als Gottesbeweis
 Von Künstlerattrappen und geistlosen Poltermimen
Von Künstlerattrappen und geistlosen Poltermimen Für Hedonisten ungeeignet
Für Hedonisten ungeeignet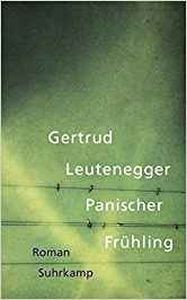 Die Frau ohne Eigenschaften
Die Frau ohne Eigenschaften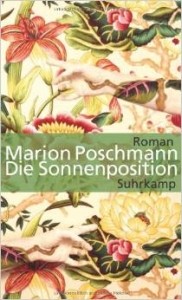 Die Sonne bröckelt.
Die Sonne bröckelt.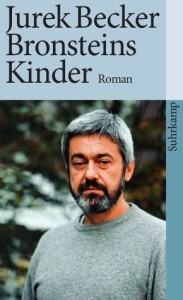 Fast ein kleines Wunder
Fast ein kleines Wunder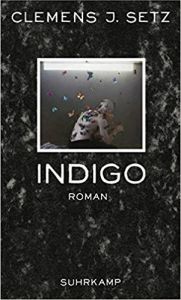 Ein müder Abklatsch
Ein müder Abklatsch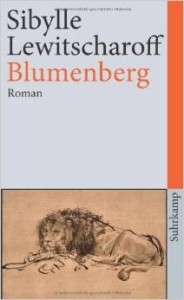 Verwirrung in der Gelehrtenstube
Verwirrung in der Gelehrtenstube