 Adrianas Kalamitäten
Adrianas Kalamitäten
Der Roman «Die Römerin» von Alberto Moravia gehört zu jener für die damalige Zeit anstößigen Literatur, die konservative Kreise in Italien 1947 nach der Veröffentlichung am liebsten gleich verboten hätten. Im Interview hat der Autor erklärt: «Mein Werk kreist um das Problem des Menschen, um das Menschliche, das Allermenschlichste, wenn Sie wollen. Die katholische Kirche hat meine Bücher auf den Index gesetzt. Pornographisch? Stelle ich nicht eher nur auch das Sinnenleben an den Platz, an dem es bei jedem einzelnen von uns steht»? Unter dem Titel «Die freudlose Strasse» wurde der Roman 1954 von Luigi Zampa, einem der führenden Vertreter des Italienischen Neorealismus, mit Gina Lollobrigida in der Hauptrolle verfilmt. Und auch für den Roman, der seinen Autor international bekannt gemacht hat, gilt jenes neue moralische Prinzip, welches «genau das als Wirklichkeit darstellt, was die bürgerliche Gesellschaft sich bemüht zu verbergen», wie Roland Barthes es formuliert hat.
«Mit sechzehn Jahren war ich wirklich eine Schönheit» lautet der erste Satz. Ich-Erzählerin Adriana lebt zur Zeit des Faschismus mit ihrer Mutter, die Hemden in Heimarbeit näht, in ärmlichsten Verhältnissen in einem üblen Viertel Roms. Ihre Mutter vermittelt sie zur Aufbesserung der Kasse als Aktmodell an verschiedene Maler, sie jedoch träumt von einem besseren Leben mit Mann und Kindern in einem schönen Haus. Ihre erste Liebe ist der Chauffeur Gino, er verspricht ihr die Ehe, sie verfällt ihm regelrecht. Ihre völlig abgestumpfte Mutter hofft insgeheim jedoch darauf, dass die Tochter endlich von selbst darauf kommt, ihre Anziehungskraft auf Männer deutlich nutzbringender, also für Geld, einzusetzen. Auch das Straßenmädchen Gisella, die beste Freundin Adrianas, redet ihr zu und lockt sie schließlich in eine Falle, wo Astarita, hoher Polizeioffizier und ihr glühendster Verehrer, die Ahnungslose mit Drohungen gefügig macht und ihr hinterher Geld dafür gibt. Nach diesem Schlüsselerlebnis, und auch weil der Polizist sie darüber aufgeklärt hat, dass ihr charmanter Gino verheiratet ist und Kinder hat, beschließt sie desillusioniert, künftig ebenfalls auf den Strich zu gehen. Sie glaubt, das sei ihre wahre Berufung, denn auch der bezahlte Sex macht ihr meistens sogar Spaß.
In den folgenden Jahren lebt sie in finanziell besseren Verhältnissen, ihre Mutter muss nicht mehr arbeiten und Adriana kann sich jetzt manches leisten. Außer den zufälligen Bekanntschaften gehört zu den Männern, die sie häufiger trifft, mit Sonzogno ein bärenstarker, gewalttätiger Verbrecher, der ihr als einziger Freier einen Lustschrei zu entlocken vermag beim Sex, dessen Grobheiten sie sogar masochistisch erregen. Mehr fürs Gemüt ist Giacomo, ein politisch aktiver Student aus bestem Hause, den sie abgöttisch liebt, obwohl er sich merkwürdig abweisend verhält, unverkennbar ein Psychopath, den sie aber demutsvoll anbetet. Und auch der unsterblich verliebte Polizist taucht immer wieder bei ihr auf und bettelt um Sex.
In diesem Geflecht von hochkomplizierten Beziehungen sind Konflikte geradezu vorgezeichnet. Alberto Moravia versteht es meisterhaft, seine Protagonistin darüber reflektieren zu lassen, sie kommt auch als einzige aus all diesen Kalamitäten heil heraus. Adriana erzählt ihre Geschichte ganz naiv in einem sprachlich anspruchslosen Stil, aber sie erzählt immer auch mit dem Herzen und zeigt bei aller Dummheit viel Mitgefühl für ihre Mitmenschen, die ihr allzu oft böse mitspielen. «Leider hat man ja beinahe immer recht, wenn man schlecht von jemandem denkt», sagt sie mal resigniert nach einer weiteren Enttäuschung. Sie ist einfach unfähig, aus ihrem fragwürdigen Beruf den maximalen finanziellen Nutzen zu ziehen oder gar Kurtisane eines reichen Freiers zu werden und in ihr Traumhaus einzuziehen, – bei ihr bleibt das Geld immer knapp. In einem spannenden Showdown mit drei Toten endet dieser Roman dramatisch, deutet ganz verschämt aber auch eine bessere Zukunft an.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
 Comment l’esprit vient aux filles
Comment l’esprit vient aux filles Eine Lust zu lesen
Eine Lust zu lesen Ein sperriges Prosawerk
Ein sperriges Prosawerk Zu liquidierender Schriftsteller
Zu liquidierender Schriftsteller Vinteuils Phrase und die Cattleyas
Vinteuils Phrase und die Cattleyas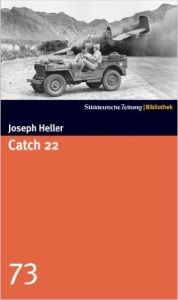 Fragwürdiger Kultroman
Fragwürdiger Kultroman Klug hinterfragtes Ich
Klug hinterfragtes Ich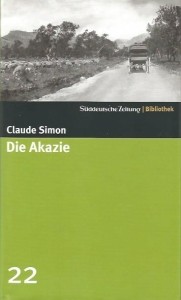 Vom innersten Menschsein
Vom innersten Menschsein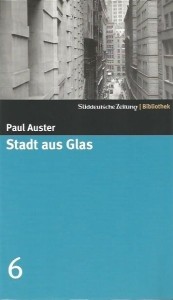 Spurensuche
Spurensuche