 Vexierbild als Mileustudie
Vexierbild als Mileustudie
Mit ihrem Debütroman «Vater unser» hat die österreichische Schriftstellerin Verena Lehner auf Anhieb einen beachtlichen Erfolg gehabt, ihr Buch gelangte 2019 auf die Longlist für den Frankfurter Buchpreis und machte sie damit in deutschsprachigen Leserkreisen bekannt. Auch das Feuilleton äußerte sich lobend, nicht zuletzt deshalb, weil hier geradezu ein Musterbeispiel für die narrative Form des unzuverlässigen Erzählens vorliegt. Was nicht verwundert, hatte die Autorin doch als Komparatistik-Studentin ihre Bachelorarbeit genau diesem Thema gewidmet. Um es gleich vorweg zu nehmen: Unzuverlässiger als die unzuverlässige junge Ich-Erzählerin Eva Gruber, die wegen einer ausgeprägten manischen Störung von der Polizei in eine Psychiatrische Klinik Wiens eingeliefert wird, weil sie, wie es heißt, eine ganze Kindergarten-Gruppe erschossen habe, launischer, inkonsequenter, sprunghafter kann man wirklich nicht erzählen.
Dieser nach dem am weitesten verbreiteten christlichen Gebet benannte, dreiteilige Roman spricht ironisch auch die Dreifaltigkeit an, in den drei mit «Der Vater», «Der Sohn» und «Der Heilige Geist» betitelten Abschnitten drückt sich spöttisch eine deutliche Ablehnung der landesweiten, katholischen Frömmigkeit aus. Gleich im ersten Teil liefert sich die manische Patientin selbstbewusst, schlagfertig und gewitzt köstliche Dispute mit ihrem Therapeuten, dem Anstaltsleiter Dr. Korb, dem sie von ihrer erzkatholischen, ländlichen Herkunft erzählt und vom Irrweg ihrer ganzen Familie. Wie sie beispielsweise vom Lehrer geschlagen wurde, weil sie das «Vater unser» nicht auswendig konnte, wie der Vater ihren jüngeren Bruder und zehn Minuten später dann auch noch sie vergewaltigt hat. Was ‹Korb›, wie sie ihn verächtlich anredet, ebenso flapsig damit kommentiert, dann müsse der Vater ja ziemlich potent sein. Arzt und Patient schenken sich nichts in ihren Therapiegesprächen, die in einem stets verschlossenen Behandlungszimmer stattfinden. Eva ist auffallend besserwisserisch, aggressiv und rotzfrech obendrein, hier ein typisches Beispiel für den permanenten, köstlichen verbalen Schlagabtausch: «‹Auch Frau Gruber›, sagt Korb und seufzt, ‹so klug sind Sie. Was hätte aus Ihnen bloß alles werden können, wenn Sie nicht so verrückt wären›. Ich nicke. ‹Ja›, sag ich, ‹wenn ich einfach nur ein bisschen blöder wär, hätt ich zum Beispiel Psychiater werden können›.» Die Beiden frozzeln sich genüsslich und lächeln noch dabei.
Was sich zunächst wie eine weitere Variante auf das literarische Genre des Psychiatrie-Romans liest, entwickelt sich im weiteren Verlauf zu einer nachdenklich machenden Anklage gegen das, was angeblich normal ist und gesund. Evas Vater hatte in seinem Zimmer einen Altar, neben dem immer ein Rosenkranz hing sowie ein gerahmtes Foto von Jörg Haider, dem Rechtspopulisten. In diversen Vignetten fragmentarisch erzählt, entwickelt sich allmählich ein Gesamtbild, das die alte Frage aufwirft, wer denn nun verrückt sei, die Patienten in der Psychiatrie oder diejenigen, die draußen sind und dort verrückt spielen. Ist das, was wir für Wirklichkeit halten, Realität – oder doch nur ein Platonsches Abbild davon? Angela Lehner zelebriert in ihrer Geschichte die Ambiguität der Geschehnisse als ein Sammelsurium des Uneindeutigen, man könnte es nach einem klugen Kopf in den USA auch alternative Fakten nennen, – als Widerspruch in sich quasi.
Wie ein Vexierbild erscheint diese klug aufgebaute Milieustudie, die in einer angenehm lesbaren Sprache den Leser absichtsvoll aufs Glatteis führt, ihn im Ungewissen lässt, schnöde die Realität negiert. Als Leser nimmt man allzu gern die Perspektive der manischen Eva Gruber ein, die an der Welt erkrankt ist, und erliegt somit dem Lesesog dieser verqueren Persiflage der Psychiatrie, in deren Verlauf sich aus der spöttischen Überlegenheit der narzisstischen Ich-Erzählerin heraus eine tiefe Verletzlichkeit abzeichnet, an deren Ende eine verzweifelte Flucht steht.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
 Manischer Erzählfuror
Manischer Erzählfuror Ein Symptom der Zeit
Ein Symptom der Zeit Seelisch bereichernd
Seelisch bereichernd Vom Kommen und Gehen
Vom Kommen und Gehen Old Filth
Old Filth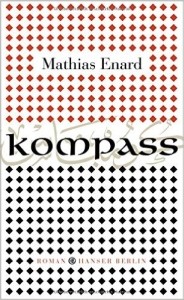 West-östlicher Divan
West-östlicher Divan