 Britischer Hype um deutschen Romantiker
Britischer Hype um deutschen Romantiker
Mit dem Titel ihres letzten, im Original 1995 erschienenen Romans verweist die englische Schriftstellerin Penelope Fitzgerald auf «Die blaue Blume» als Sinnbild romantischer Poesie, welches auf Sehnsucht, Liebe und Fernweh ebenso hinweist wie auf die Unendlichkeit. Florales Vorbild ist laut Novalis der blaue Heliotrop, in seinem Romanfragment «Heinrich von Ofterdingen» hat er sie erstmals als metaphysisches Symbol verwendet. Jene mystische Blume, die niemals gefunden werden könne, symbolisiere, wie Fitzgerald es ausdrückte, was man selber vom Leben will, ein Ziel, das man unbeirrt anstreben muss, auch wenn es vergebens zu sein scheine. Im vorliegenden Roman versinnbildlicht die blaue Blume die tragische Liebesgeschichte zwischen Friedrich von Hardenberg, der später als frühromantischer Dichter unter dem Synonym Novalis berühmt wurde, und der blutjungen Sophie von Kühn. Der in England als Meisterwerk gelobte historische Roman gilt als Höhepunkt im Œuvre dieser Schriftstellerin, als ihr gelungenstes und anspruchsvollstes Werk.
Zeitlich umfasst ihre Geschichte die Jahre von 1790 bis 1797. Fritz, wie der junge Hardenberg in der Familie genannte wurde, begegnet Ende 1794 erstmals der 12jährigen Sophie, eine «Viertelstunde», die über sein Leben entschieden habe, wie der damals 22Jährige seinem Bruder schrieb. Keine drei Jahre später stirbt Sophie an Tuberkulose, eine in jenen Zeiten meist tödlich verlaufende Krankheit, der Fritz vier Jahre später ebenfalls erlag. Die kurze Spanne dieser Liebesgeschichte bildet den inneren Kern der Erzählung. Gegliedert in 55 Kapitel, ergänzt um ein Nachwort, ist dieses Buch, wie die Autorin es ausdrückte, eine «Art Roman», stellt also im Wesentlichen eine fragmentarische Biografie des Dichters Novalis dar, aber auch eine um Fiktionales ergänzte, historisch aufschlussreiche Schilderung dieser Epoche. Der vielseitig gebildete Novalis verkehrt mit Geistesgrößen seiner Zeit, steht mit Schiller, Goethe, Schlegel, Fichte und anderen auf vertrautem Fuß. Aber auch Profanes hat seinen Platz in diesem kleindeutschen Milieu mit Jena und Weimar als geistiger Mittelpunkt, ob dies nun die finanziell angespannte Lage der Familie Hardenberg mit ihren elf Kindern ist oder kaum zu glaubende Praktiken der Mediziner, der pietistisch den Herrnhutern hörige Vater ebenso wie die Charaktere der skurrilen Familienmitglieder und ihre eigenartigen Rituale, beim Frühstück oder zu Weihnachten. Auch das uns Heutige äußerst rüde erscheinende Alltagsleben auf einem abgewirtschafteten Gutshof, die englische Autorin gibt uns gut recherchierte Einblicke in die damaligen Lebensverhältnisse.
Indem Fitzgerald sich mit begleitenden Hinweisen und Erklärungen, die sie als «Beleidigung des Lesers» empfunden hat, ganz bewusst zurückhält, die Geschehnisse also ungeschönt, ganz unkommentiert auf ihn einwirken lässt, erhalten ihre kurzen Episoden eine einzigartig direkte Wirkung, erhellen das Wesen ihrer zahlreichen, lebensprall gezeichneten Figuren und deren verbindendes Beziehungsgeflecht. Besonders bedrückend wirkt deshalb am Ende auch die knappe Schilderung von Sophies Todesstunde. Fritz kann sie nicht anlügen, ihren sich verschlimmernden Zustand nicht schönreden, er verlässt den Gutshof ohne Abschied, ohne seine übliche Beteuerung: «Sophie, du bist die Seele meiner Seele».
Zweifellos ist es der Autorin gelungen, uns einen großen Dichter der Romantik nahe zu bringen. Wichtigstes Thema jedoch ist die rätselhafte Anziehungskraft zwischen Liebenden und ihr letztendlich schmähliches Versagen vor dem Menetekel des nahenden Todes. Ihre Sprache ist schnörkellos, wirkt allerdings recht holzschnittartig, die Handlung zudem ist allzu sprunghaft erzählt, was dem Lesevergnügen ziemlich abträglich ist. Der große Erfolg im englischsprachigen Ausland dürfte in der dort unbekannten Thematik um den Dichter Novalis begründet sein, kaum in den literarischen Qualitäten dieses Romans.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
 Weniger wäre mehr gewesen
Weniger wäre mehr gewesen Nicht mal Mittelmaß
Nicht mal Mittelmaß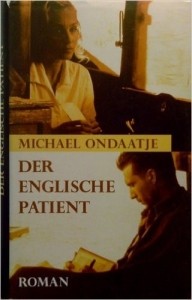 Mit Herodot in der Wüste
Mit Herodot in der Wüste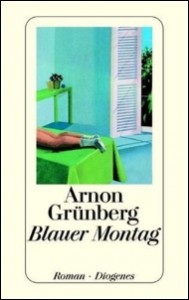 Null Bock auf nichts
Null Bock auf nichts Verlorene Zeit
Verlorene Zeit Vom Scheitern des American Dream
Vom Scheitern des American Dream … und alle Fragen offen
… und alle Fragen offen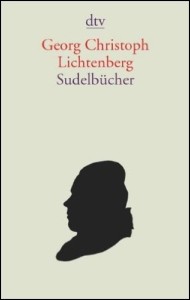 Gar nicht hohl
Gar nicht hohl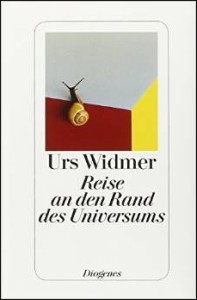 Genese eines Schriftstellers
Genese eines Schriftstellers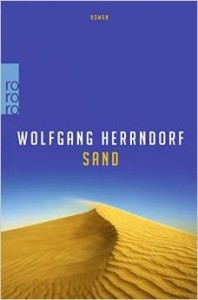 Sie dürfen Watson zu mir sagen
Sie dürfen Watson zu mir sagen Read it four times
Read it four times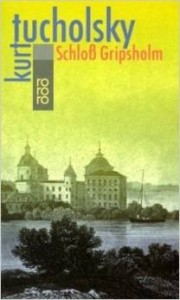 Ich dichte erst ab 12 %
Ich dichte erst ab 12 %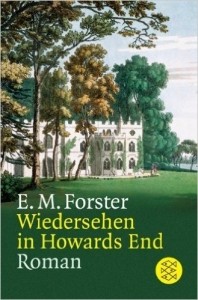 Tea Time
Tea Time Transzendentale Herausforderung
Transzendentale Herausforderung