Dem ers ten Teil seines Buches „Der Bücherprinz“ vorangestellt hat der Autor Ruprecht Frieling ein kurzes Gedicht von Tschingis Aitmatow. Zusammengefasst schreibt Aitmatow – nichts aus der Kindheit wird je vergessen, es begleitet uns bis ans Ende unserer Tage. Es war sicher Ruprecht Frielings Kindheit und Jugend, die aus ihm das machten, was er wurde – ein Revoluzzer, der er bis heute geblieben ist. Auch die langen Haare, das Wahrzeichen aller Widerständler der damaligen Zeit, trägt er heute noch.
ten Teil seines Buches „Der Bücherprinz“ vorangestellt hat der Autor Ruprecht Frieling ein kurzes Gedicht von Tschingis Aitmatow. Zusammengefasst schreibt Aitmatow – nichts aus der Kindheit wird je vergessen, es begleitet uns bis ans Ende unserer Tage. Es war sicher Ruprecht Frielings Kindheit und Jugend, die aus ihm das machten, was er wurde – ein Revoluzzer, der er bis heute geblieben ist. Auch die langen Haare, das Wahrzeichen aller Widerständler der damaligen Zeit, trägt er heute noch.
Als Ruprecht 1952 in Oelde / Westfalen, das trübe Licht dieser Welt erblickte, gab es den Kaiser nicht mehr, auch Adolf Hitler war von der Weltbühne abgetreten, aber sie hatten in den Köpfen der Deutschen unauslöschliche Spuren hinterlassen, die – wenn man es genau betrachtet – bis heute nachwirken. Furzen in der Öffentlichkeit kostete zur Kaiserzeit 5 Mark Strafe, ersatzweise 1 Tag Haft. Conny Froboess packte damals gerade ihre Badehose ein, denn Nacktheit war untersagt, und ich kann mir vorstellen, dass die Hose, heruntergezogen am falschen Ort, mehr kostete, als 5 Nachkriegs-Mark und dass die Ersatzhaft, wenn man nicht zahlen konnte oder wollte, nicht in Tagen, sondern Monaten bemessen war.

Noch angepasst mit fünf …
Ruprecht kam in ein – für damalige Verhältnisse – wohlgeordnetes Elternhaus. Sein Vater war streng, schließlich sollte aus dem kleinen Ruprecht ja mal was werden, ein angepasster Befehlsempfänger in den Fußstapfen seines Vaters. Und die Mutter, ebenfalls an die damaligen Vorstellungen von Familie, Recht und Ordnung angepasst (KKK – Kirche/Kinder/Küche), war ganz auf der Linie des Herrn Gemahls.
Strenge bedeutete das, Prügelstrafe, Ordnung. Gegessen wurde zu festen Zeiten, am zentralen Treffpunkt der Familie, einem ausziehbaren (wenn Gäste kamen) Holztisch im Esszimmer. Wenn ich das einfließen lassen darf – ich kenne diese Rituale auch. Wer bei uns abends um 7 Uhr nicht wartend mit gewaschenen Händen hinter seinem Stuhl stand, durfte gleich weiter ins Bett marschieren. Mit leerem Magen.
Menschliche Nähe? Dafür hatte man bei den Frielings Personal: Kinderfräulein, Zimmermädchen und für jegliche Arbeit, bei der man sich die Finger schmutzig machen konnte, gab es den Gärtner und hinter dem Lenkrad eines Autos sitzen war für den Herrn des Hauses nicht opportun; der Chauffeur war dafür zuständig. Das Kinderfräulein (das Fräulein war noch nicht aus der deutschen Sprache verbannt), hat mit einem aufgeschminkten Leberfleck zu Ruprechts ersten sexuellen Fantasien beigetragen und man darf annehmen, dass sie deshalb nur kurze Zeit im Hause Frieling arbeitete.

Mit 14 bereits auf einem eigenen Weg …
Zu allen Negativpunkten gab es mindestens einen positiven, das waren die vielen Bücher, verstaubte Folianten in gut riechenden ledernen Einbänden. Ruprecht griff wie ein Ertrinkender nach allem, was in irgendeiner Form mit Buchstaben bedruckt war. Wie sagte Tschingis Aitmatow? Nichts aus der Kindheit wird vergessen! Die Bücher, auf Papier gedruckt, inzwischen auch auf elektronischem Papier, verfolgen Ruprecht bis heute, denn er wurde ein bekannter und zu Recht gefeierter Verleger. Auch der Siegeszug des eBooks in Deutschland und der Selfpublisher gehen – mindestens teilweise – auf ihn zurück.
Als ich das las, habe ich im ersten Moment gestutzt, weil ich glaubte, das eBook habe doch mit der elektronischen Vernetzung zwangsläufig in der Luft gelegen. Bis mir klar wurde, dass auch dafür Revoluzzer gefragt waren, die nicht bis in alle Ewigkeit auf der Mainstream-Welle der Verlage mitschwimmen wollten.

Mit 19 hatte er noch Träume …
Wenn man es genau betrachtet, dann muss Ruprecht wohl schon als Nicht-Angepasster auf die Welt gekommen sein, denn bei aller Strenge der sich liebevoll gebenden Eltern, muckte er immer wieder auf. Nachhaltig kann man auf Neu-Deutsch ohne Übertreibung sagen. Nicht einmal Messdiener wollte er werden, obwohl das durchaus in der Tradition der Familie gelegen hätte. Allerdings – das muss man schon sagen – er hatte sich spitzbübisch, wie er nun mal ist, eines Helfershelfer bedient. Er hatte IHN da OBEN um ein Zeichen gebeten, dann hätte er ja gewollt. Dieses Zeichen kam nicht, womit sich Ruprecht sagte: nun denn – wenn es so sein soll …
Beinahe zwangsläufig führte sein aufmüpfiges Verhalten zu unerfreulichen Maßnahmen, aber es musste sein, schließlich sollte aus dem Jungen ja mal „was“ werden, was Respektable, wie der Herr Vater. Als dem prügelnden Vater und der geduldig dem brutalen Treiben zuschauende Mutter nichts mehr einfiel, wanderte Ruprecht in eine Jugendpsychiatrie. Treibende Kraft war die Mutter, aber man muss das verstehen, sie wollte ja nur das Beste für den Jungen und von den abfälligen Bemerkungen ihrer Freundinnen über Ruprechts Fehlverhalten hatte sie auch genug! Damit das alles auch Recht und Ordnung hatte, gab es auf Basis eines Gefälligkeitsgutachtens eines Kinderarztes (der ohne jegliche psychologische Erfahrung war) auch einen richterlichen Beschluss. Ein Chauffeur seines Vaters sammelte ihn ein und fuhr ihn im familieneigenen hochherrschaftlichen Mercedes in einer filmreifen Aktion in die Psychiatrie.

Mit 21 arbeitete er bereits im Steinbruch der Worte …
Der junge Ruprecht, gerade 15 Jahre alt, hatte Probleme mit den dunklen Nächten in der Irrenanstalt, dem nächtlichen Geheule inhaftierter Triebtäter, Mörder und sonstiger Unholde. Nicht gänzlich unerwartet, wie man zugeben muss. Die Pfleger verabreichten ihm viele grüne, blaue und gelbe Pillen, die ihm Schlaf verschaffen sollten. Das taten sie nicht, denn Ruprecht kotzte sie in unbeobachteten Momenten in die Toilette. Wen wundert’s, dass sein bester Freund und Beschützer während dieser Zeit ein noch junger Triebtäter wurde, der mehrere Verwandte mit einem Küchenmesser abgeschlachtet hatte.
Nach einigen Wochen kam es zu einer Revolte in der Anstalt, an der Ruprecht nicht beteiligt war, die aber wohl mit zu seiner Freilassung beitrug. Mindestens fielen den Ärzten keine weiteren Gründe mehr ein, ihn weiter festzuhalten und wohl oder übel musste man ihn freilassen.
Ruprecht ließ sich nicht kleinkriegen, Vater und Mutter schafften es nicht, die Psychiatrie nicht und auch nicht die Prügelstrafen der Lehrer in einigen darauf folgenden Gymnasien. Irgendwann wurde es ihm zu viel, vielleicht war er es auch satt, weiter seinen Eltern „Schande“ zu bereiten, und er ging auf Wanderschaft. Nach der ersten Station London, und dort ersten Kontakten zur Hippieszene, ging es weiter über Amsterdam, Paris, Dubrovnik und Kurdistan. Endlich trat das ein, was er sich wohl während seiner ganzen Kindheit und Jugend gewünscht hatte – Oelde, seine Heimatstadt, verschwand immer tiefer hinter dem Horizont.
Beinahe zwangsläufig setzte Ruprecht sich nach West-Berlin ab, denn der vom Kreiswehrersatzamt angekündigte Wehrdienst war nicht nach seinem Geschmack. Gemäß Berlin-Statut der Siegermächte war er dort sicher. In Berlin traf er auf alles, was damals im mehr oder weniger illegalen Untergrund Rang und Namen hatte, angefangen bei Fritz Teufel und vielen anderen. Auch normalisierte sich hier seine vom Oelder Elternhaus nachhaltig gestörte Beziehung zum anderen Geschlecht. In den dunklen Schlafräumen der WGs fand er bald heraus, dass es nicht so wichtig ist, mit wem man „es macht“, sondern, „dass“ man „es macht“.
Trotz aller Freiheiten in Westberlin, des links geprägten Denkens, merkte er bald, dass das Leben durchaus Schattenseiten haben kann, wenn man als eine Art Tagelöhner in aller Herr-Gott’s-Früh anstehen muss, um wenig Arbeit und noch weniger Geld zu bekommen. Diese Erkenntnis hatte ganz sicher nichts mit Anpassung zu tun, sondern schlicht damit, dass zu einigen Annehmlichkeiten des Lebens Geld gehört. Der Joint kostet Geld, das Bier, schmackhaftes Essen auch, und dafür muss man arbeiten.
Weil ihm der frühmorgendliche „Sklavenmarkt“ nicht behagte, sprich Anstehen nach Arbeit, wurde Ruprecht Fotograf. So ein richtiger mit Lehre, sprich fotografischer Ausbildung. Bis er endlich dort landete, was seiner eigentlichen Berufung entsprach – er wurde Journalist. Es waren wohl die dicken verstaubten Folianten seines Elternhauses, in Kalbsleder gebunden, die sich letztendlich bei ihm durchsetzten.

… in dem er mehr als 40 Jahre später immer noch aktiv ist …
Es folgten prägende Episoden als Journalist in der DDR (damals durchaus keine Selbstverständlichkeit!), auf Kuba (auch nicht üblich) und in einigen Westberliner Redaktionen. Während dieser Zeit traf er auf viele Menschen, die sich wie das Who is Who der deutschen Nachkriegsära lesen. In der langen Liste seines Bekanntenkreises der darstellenden und bildenden Künste fehlen weder Fassbinder, noch Hanna Schygulla, um nur zwei zu nennen, mit denen er beruflich und freundschaftlich, schreibend oder als Fotograf, verbunden war.
Man kann sagen, der Sprung ins Verlagswesen und zum eigenen Verlag erfolgte wie unter Zwang. Er veröffentlichte nicht nur viele Autoren, sondern verfasste auch selbst Bücher. Und das mit viel Erfolg, denn trotz allen Revoluzzertums hat Ruprecht bis heute eine untrügliche Nase für das Geschäft. Dazu gehörten dann, einem Trend folgend, Sachbücher wie „Berlin okkult“, „Rock-City Berlin“ oder ein Stadtführer für Behinderte.

… um von Freunden liebevoll als »E-Book-Papst« bezeichnet zu werden
Mit zu seinem Erfolg gehört sicher auch, dass er sich sehr frühzeitig moderner Technik bediente. Das war ein Computer mit dem hübschen Namen “Lisa”, so benannt nach Steve Jobs Tochter, des Apple-Gründers. Vielleicht war es auch dieser in jenen Jahren gar nicht so selbstverständliche Umgang mit Technik, der ihn frühzeitig das Potential der eBooks erkennen ließ.
Das Buch „Der Bücherprinz“ ist eine Autobiografie, es ist darüber hinaus aber noch viel mehr. Es beschreibt die Zeit des Aufbruchs in Westdeutschland und in Westberlin. In diese Zeit fällt das Aufmucken der Jugend, die Proteste gegen den Besuch Schah Mohammad Reza Pahlavi, der diese Epoche der neueren deutschen Geschichte einläutete. Die Jugend hatte genug vom autoritären Staat, sie wollte frei sein und Ruprecht Frieling war einer von ihnen. Es ist gut, dass er mich, uns alle, daran erinnert, wie das damals war, was die Jugend in die Hippieszene, in den Widerstand getrieben hat.

Mit seinem »Bücherprinz« wirft Frieling einen Blick hinter die Kulissen
Ich habe das Buch mit großer Begeisterung und vielen Erinnerungen und des Nachdenkens gelesen, denn mir scheint, Rupi, Du beschreibst auch etwas, was inzwischen so vielen Menschen abhanden gekommen ist. Weniger „Ja“ brüllen, weniger „Nicken“, mehr Revoluzzertum. Ein wenig nur wäre schon hilfreich, sonst landen wir alle noch in einer Ecke, die wir glaubten, 1945 hinter uns gelassen zu haben.
Abgesehen vom geschichtlichen Hintergrund dieser Autobiografie ist es auch die Sprache, die Rupis Buch überaus lesenswert macht. Es ist dieser nett klingende, zwischen den Buchstaben herausspringende Sarkasmus, der selbst unangenehme Erinnerungen, wie die Erlebnisse in der Psychiatrie, erträglicher erscheinen lassen.
Rupi, ich danke Dir für dieses Buch. Aus vielerlei Gründen hat es mir gut getan, denn ich bin auch nicht „angepasst“, wie Du weißt, bin auch abgehauen. Hurra schreien konnte ich auch nie, genauso wenig wie Du.
Zum Bestellen klicken Sie bitte hier: Der Bücherprinz
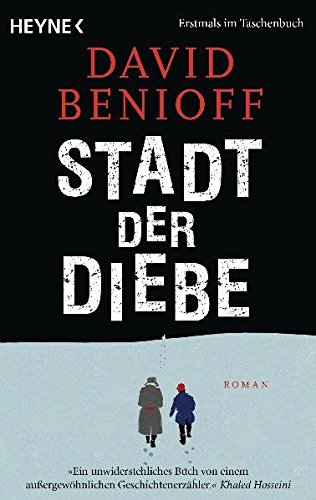 Wir schreiben das Jahr 1943. Die Stadt der Diebe von David Benioff – das ist Leningrad. Diebe haben Konjunktur, denn deutsche Truppen haben die Stadt eingeschlossen und die Bewohner sind kurz vor dem Hungertod.
Wir schreiben das Jahr 1943. Die Stadt der Diebe von David Benioff – das ist Leningrad. Diebe haben Konjunktur, denn deutsche Truppen haben die Stadt eingeschlossen und die Bewohner sind kurz vor dem Hungertod.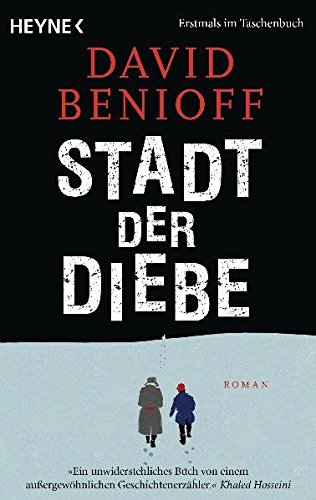
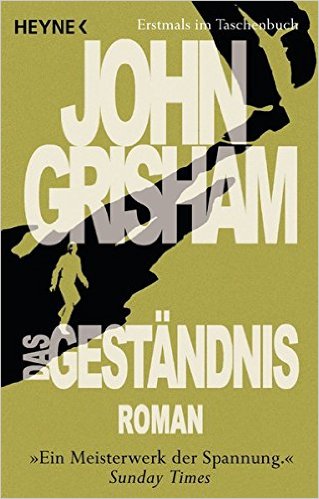
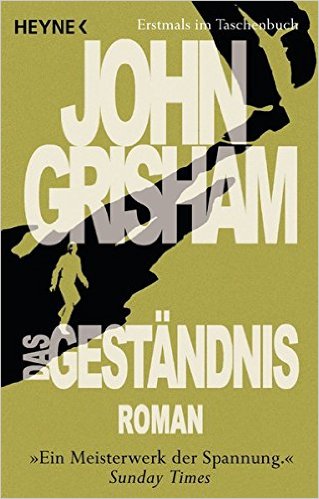

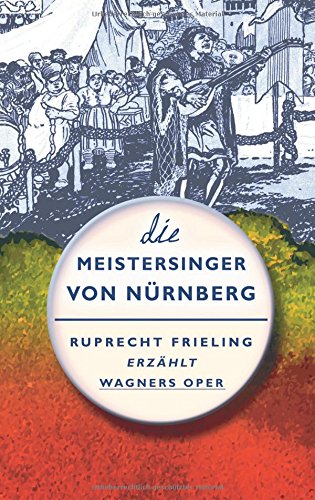
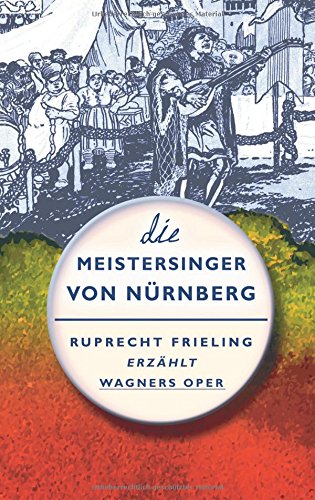










 „Marionetten“ von John le Carré erschien 2008 in deutscher Sprache. Man darf annehmen, dass le Carré den Roman unter dem Eindruck der furchtbaren Ereignisse in New York etwa 2003, also heute vor über 10 Jahren geschrieben hat.
„Marionetten“ von John le Carré erschien 2008 in deutscher Sprache. Man darf annehmen, dass le Carré den Roman unter dem Eindruck der furchtbaren Ereignisse in New York etwa 2003, also heute vor über 10 Jahren geschrieben hat.